Schule
Wie können Schulen agiler werden? Welche Methoden eignen sich in der Praxis? Und was macht eine agile Schulführung aus? Erfahren Sie hier mehr über das Thema agile Schulentwicklung und erhalten Sie Einblicke in erfolgreiche Praxiskonzepte.
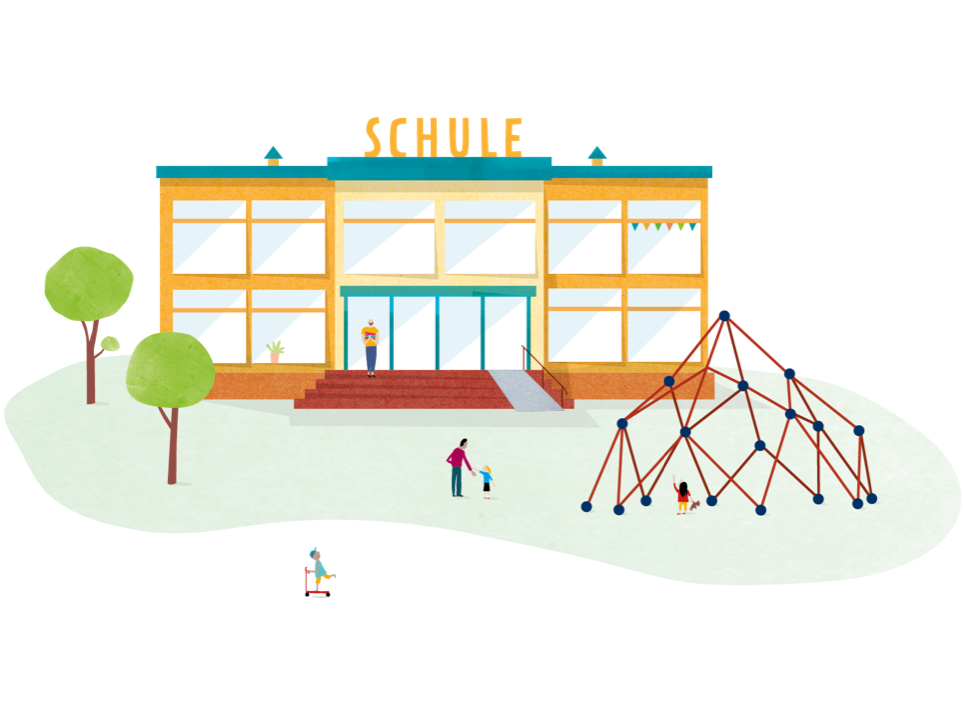
Agil ist eine Haltung
Agilität ist das Schlagwort, wenn es um den digitalen Wandel geht. Agil bedeutet aktiv, flexibel und anpassungsfähig zu sein. Diese Fähigkeiten sind auch notwendig, um das Lehren und Lernen an Schulen weiterzuentwickeln und den Herausforderungen in einer immer unsicheren, schnelllebigeren und komplexeren Welt zu begegnen. Auch Schulentwicklungsprozesse können agil umgesetzt werden. Das gelingt aber nur, wenn die Organisationskultur an der Schule das zulässt und sich die Zeit für Veränderungsprozesse genommen wird. Eine agile Organisation ist anpassungsfähig, gestaltungsfähig und innovationsfähig und versteht sich überdies als eine lernende Organisation. Es braucht eine Kultur der Teilhabe, Eigenverantwortung und Kommunikation auf Augenhöhe.
Agile Schulführung
Ziel einer agilen Schulführung ist es, die Anforderung eines Schulalltags nach Stabilität zu bedienen ohne als Gesamtes zu starr zu sein. Der Schweizer Organisationsberater Menno Huber nennt das „bewegliche Stabilität“. Organisationen sollen wandlungsfähig und lebendig bleiben, indem Bestehendes in Frage gestellt und Veränderungen zukunftsorientiert und mit kreativen Methoden in Angriff genommen werden1.
Aber wie arbeitet und führt man nun agil? Was allgemein für Schulentwicklungsprozesse gilt – es gibt kein ,one size fits all‘ – gilt genauso für einen Wandel hin zu einer agilen Organisation. Jede einzelne Schule entwickelt ihre eigenen Logiken. Es gibt daher kein einheitliches Schema, nach dem alle vorgehen müssen. Es gibt aber eine Reihe von Ansatzpunkten2.
Impuls: Grundlagen der agilen Schulentwicklung
Berit Moßbrugger und Till Jaspert vom innovationhub.schule stellten in ihrem Impuls, den sie im Rahmen der Digitalen Lernreise hielten, Grundlagen und Tools der agilen Schulentwicklung vor.
Die sechs Prinzipien agiler Schulführung
Paradoxien managen
Agile Führung ist sich der Paradoxien in ihrer Organisation bewusst und thematisiert sie. Sie hält Widersprüchlichkeiten aus, ohne gleich eine Entscheidung zu fällen.
Der Alltag von Leitungskräften ist von Widersprüchlichkeiten geprägt. Es gibt selten die eine richtige Lösung. Hier ist Ambiguitätstoleranz gefragt, also zunächst das Aushalten von sich widersprechenden Gegebenheiten. Ein erster Lösungsansatz kann die Kommunikation über die Situation sein. Allen muss die Unmöglichkeit einer einzigen richtigen Entscheidung bewusst sein. Normalerweise wird eine Entscheidung für das eine oder das andere getroffen. Oft sind aber beide Alternativen sinnvoll. Eine Person kann nur eine Option umsetzen, wohingegen mehrere Personen verschiedene Dinge gleichzeitig tun können. „Eine Organisation versetzt sich also durch Arbeitsteilung in die Lage, sowohl das eine als auch das andere und zusätzlich weitere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.“ (Huber 2019, S.20). Dafür braucht es Koordination und Steuerung, also Führung.
Projektarbeit in kleinen Schritten
Agile Führung sorgt für ein gleichmäßiges Tempo in der Schulentwicklung auf unbegrenzte Zeit, ohne die Mitarbeitenden zu überfordern. Agiles Projektmanagement ersetzt langfristige Planungen durch die Orientierung an einem Zukunftsbild und dem Prozess sowie durch Projektarbeit in kleinen Schritten.
Um gemeinsam agieren zu können, braucht es in Organisationen eine gemeinsam entwickelte und getragene Vision von der Zukunft, an der sich alle orientieren können. Sie sollte nicht zu detailliert sein, um ausreichend Spielraum für Unvorhergesehenes zu lassen. Bei der Umsetzung ist darauf zu achten, dass nur so viele Projekte angegangen werden, wie neben dem Tagesgeschäft zu bewältigen sind. Durch kleinschrittige Prozesse, in denen immer nur der nächste Schritt geplant und umgesetzt wird, können Veränderungen integriert und Prozesse flexibel angepasst werden. Das ist hingegen bei langfristigen Planungen nicht möglich und sorgt bei den Beteiligten häufig für Frust.
Fokus auf Schul- und Unterrichtsqualität
Die Mitarbeitenden in einer zukunftsfähigen Schule orientieren sich an einer gemeinsamen pädagogischen Grundhaltung.
Neben dem gemeinsamen Zukunftsbild ist die pädagogische Haltung für gute Qualität in Schulen entscheidend. Diese Grundhaltung sollte innerhalb der Organisation übereinstimmen und so einen Gestaltungsspielraum für jeden Einzelnen definieren. Dabei ist es wichtig, die pädagogische Haltung fortlaufend zu thematisieren und neuen Mitarbeitenden von Anfang an eine entsprechende Einführung zu geben.
Veränderungen erkennen und aufgreifen
Zukunftsfähige Schulen verfügen über Beobachtungs- und Führungsinstrumente, mit denen sie interne und externe Veränderungen wahrnehmen und aufgreifen.
Auf Veränderungen kann man nur reagieren, wenn man sie kennt. So ist es für agile Schulen von Bedeutung, die Schule selbst sowie das nähere und weitere Umfeld – bis hin zur ganzen Gesellschaft – genau zu beobachten. Hilfreich ist dabei, regelmäßig Daten heranzuziehen (siehe Leit-IDEEN „Datengestützte Schulentwicklung“) und aktuelle Forschungsergebnisse als Entscheidungsgrundlage zu nutzen. So können zum Beispiel Effekte von Interventionen überprüft oder der Ressourceneinsatz angepasst werden.
Selbstorganisation und Zusammenarbeit fördern
Agil geführte Schulen geben sich eine bewegliche Stabilität durch schlanke Strukturen mit kleinen pädagogischen Teams und kurzen Entscheidungswegen.
Das Aufteilen von Schulen in kleine Einheiten selbstorganisierter pädagogischer Teams mit Entscheidungsund Finanzkompetenz ermöglicht agiles Arbeiten und fördert das Engagement. Diese Struktur bedarf Koordination und Rahmensetzung durch die Führung. Verbindliche Prozesse regeln die Zusammenarbeit der Teams und werden regelmäßig reflektiert und angepasst. Das alles gilt auch für das gesamte Bildungssystem. Die kleineren Einheiten sind dann die Schulen mit größtmöglichen Entscheidungsbefugnissen. „Es besteht eine klare Rollenverteilung zwischen der operativen Leitung einer Schule, der strategischen Führung durch die politischen Organe und der Bildungsverwaltung als Dienstleisterin.“ (Huber 2019, S. 27)
Komplexität reduzieren
Die agile Schulführung ist sich der Komplexität von Schulen bewusst und reduziert sie, ohne unzulässig zu vereinfachen.
Eine Schule mit all ihren Prozessen und allen direkten und indirekten Beteiligten ist ein hoch komplexes System. Gleichzeitig ist ein Ziel agilen Arbeitens, Dinge zu vereinfachen und so überhaupt erst bearbeitbar zu machen. Beim kleinschrittigen Vorgehen ist es oft erfolgsentscheidend, das große Ganze nicht aus den Augen zu verlieren.
Die sechs Prinzipien agiler Schulführung nach Menno Huber (2019) lassen sich auf einzelne Schulen wie auch auf das Schulsystem als Ganzes anwenden. Sie basieren auf der Annahme, dass sich Organisationen dann erfolgreich führen lassen, wenn die Haltung der Führung auf allen Ebenen kongruent ist. Im besten Fall finden die Prinzipien sich also in Schule, Behörde und Verwaltung wieder.
- SCRUM
-
Scrum ist ein Arbeitsrahmen mit klaren Abläufen und definierten Rollen, in dem agile Teams Projekte flexibel und selbstorganisiert umsetzen können. Dazu gehören regelmäßige Treffen, um sich gegenseitig zu informieren, zu reflektieren und die nächsten Schritte abzustimmen. Aufgaben werden nicht detailliert geplant, sondern in vorgegebenen Etappen (siehe Sprint) abgearbeitet. Scrum kann für mehr Agilität bei der Projektarbeit im Unterricht und im Kollegium sorgen.
- KANBAN
-
Bei dieser Methode werden auf einem Board alle Aufgaben eines Teams mit Post-ist visualisiert. Jeder Klebezettel repräsentiert eine Aufgabe, deren Status in den Spalten „noch offen“, „in Bearbeitung“ oder „erledigt“ abgebildet wird. Ziel ist es, die Menge gleichzeitig begonnener Arbeit zu begrenzen, Engpässe im Arbeitsfluss sichtbar zu machen und dadurch Arbeitspakete schneller umzusetzen.
- DESIGN THINKING
-
Diese agile Methode ist zugleich ein kreativer Denkansatz zur Ideenfindung und Problemlösung. Multidisziplinäre Teams mit unterschiedlichen Sichtweisen und Ansätzen entwickeln in einem kreativen Prozess systematisch innovative Lösungen für komplexe Probleme. Die Methode eignet sich sowohl für Schulentwicklungsprojekte als auch für den Einsatz im Unterricht.
- STAND-UP
-
Das Stand-up ist ein kurzes, tägliches Treffen eines Teams, um sich stehend über den aktuellen Status von Projekten auszutauschen: Was habe ich geschafft? Woran arbeite ich als nächstes? Was hindert mich an meiner Arbeit?
Dauer: ca. 15 Minuten. - SPRINT
-
Ein Sprint ist ein fester Zeitraum, in dem sich ein Team verpflichtet, einen bestimmten Arbeits-umfang abzuarbeiten. In einer detaillierten To-Do-Liste, dem sogenannten Backlog, werden alle Aufgaben eingetragen und abgehakt, die in dem Sprint zu bearbeiten sind. Übliche Dauer: 2-4 Wochen.
______________________________________________________________________________________
Agile Methoden im Überblick
Scrum, Sprint, Kanban – Worum geht es dabei? Wir stellen Ihnen die gängigsten agilen Methoden kurz vor:
Schulische Praxiseinblicke
Wie sieht agile Schulentwicklung in der Praxis aus? Die beiden nachfolgenden Schulen stellen sich im Rahmen der Lernreise vor und geben einen Einblick in ihre Praxiskonzepte.
International School Stuttgart
Die 1985 gegründete International School Stuttgart (ISS) bildet mehr als 800 Studenten aus rund 50 verschiedenen Ländern an zwei separaten Standorten aus. Dabei setzt die Schule auf ein erfahrungsorientiertes und schüler:innenzentriertes Curriculum. Während am Campus Degerloch Schüler:innen ab dem 3. Lebensjahr bis zur 12. Klasse beschult werden, betreut der Campus Sindelfingen Schüler:innen von 4 Jahren bis zur 10. Klasse. Anerkannt durch das Land Baden-Württemberg, bietet die ISS eine internationale Ausbildung an, die von der New England Association of Schools and Colleges und der International Baccalaureate Organization als MINT/Digitale Schule akkreditiert und autorisiert ist. Agiles Arbeiten hat einen hohen Stellenwert an der ISS. Über die Beweggründe und Schritte hin zu einer agilen Schulentwicklung werden Anja Junginger, Strategic Development Managerin, und Scott Jackson, Head of Campus Sindelfingen, im Rahmen der Lernreise berichten.
St. Nicholas, Sao Paulo, Brasilien
An der 1980 gegründeten St. Nicholas School in Sao Paulo (Brasilien) lernen aktuell über 900 Schüler:innen aus über 50 Ländern am Campus Pinheiros und Alphaville. Kulturelle und sprachliche Vielfalt wird an der Schule ebenso gefördert wie die Lernkompetenzen des 21. Jahrhunderts – darunter das kreative Denken, die Problemlösungsfähigkeit und effektive Kommunikation. Pädagogischer Schulleiter ist Nick Thody, der während der Lernreise das 2-stufige, partizipative Schul- und Unterrichtsentwicklungsprojekt vorstellen wird.
_________________________________________________________________________________________
1 Huber, M.: Schulen agil gestalten, entwickeln und führen. Heidelberg: Carl Auer Verlag, 2019, S. 18
2 Träutlein, S.; Jesacher-Rößler, L.: Ein Blick über den Tellerrand: Erfahrungen aus der Softwareentwicklung. In: Journal für Schulentwicklung. 23. Jahrgang 2019, S.20


