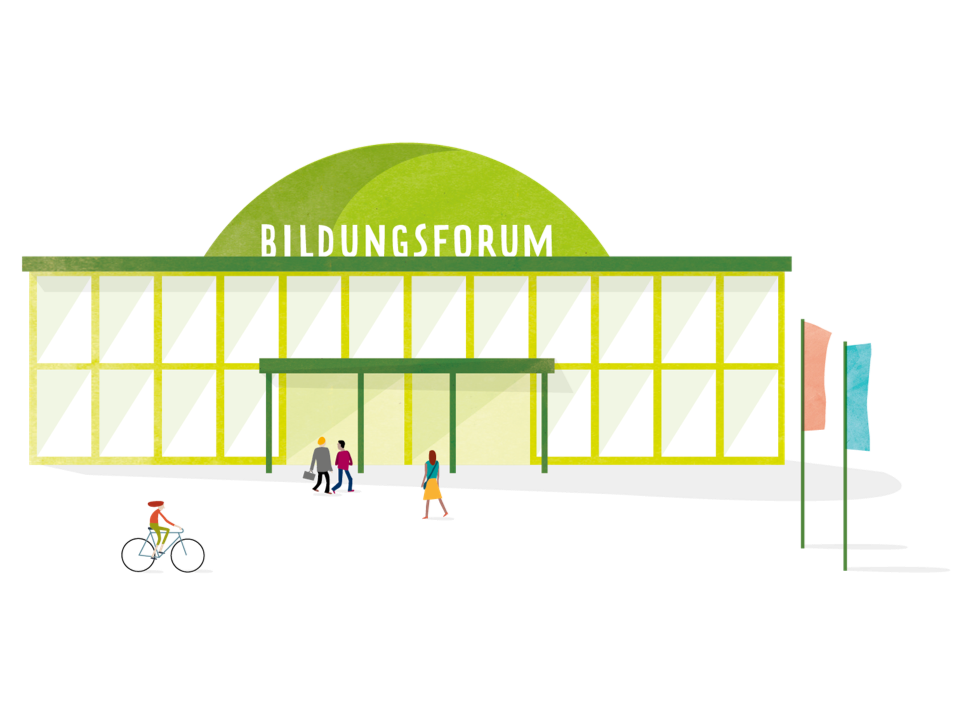Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist als deutsches Bundesgesetz am 18.08.06 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz werden vier Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft zum Schutz vor Diskriminierung in nationales Recht umgesetzt. Ziel ist es, Benachteiligungen zu verhindern oder beseitigen, die sich einem von sieben Gründen zuschreiben lassen (§ 1 AGG). Dazu zählt unter anderem:
- Geschlecht: Der Schutz gilt für Frauen, Männer, Trans*Personen und intergeschlechtliche Menschen.
- sexuelle Identität: Niemand darf aufgrund der sexuellen Identität benachteiligt werden. Der Begriff bezieht sich auf lesbische, schwule, hetero- und bisexuelle sowie asexuelle Menschen.
- Religion bzw. Weltanschauung: Die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer Religion oder Weltanschauung sowie deren Ausübung ist geschützt.
- eine Behinderung: Menschen gelten als behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit dauerhaft eingeschränkt ist und in Wechselwirkung mit Barrieren aus dem sozialen Umfeld die Teilhabe an der Gesellschaft nachhaltig beeinträchtigt sein kann. Auch bei chronischen Erkrankungen können solche Barrieren für die gesellschaftliche Teilhabe entstehen.1
- Alter: Der Schutz vor Diskriminierung bezieht sich hierbei auf das Lebensalter allgemein. Somit sind Ungleichbehandlungen wegen eines zu jungen oder zu alten Alters untersagt.
Die Aufzählung von Gründen erfasst allerdings nicht alle Merkmale, aufgrund derer Menschen in unserer Gesellschaft diskriminiert werden. So werden beispielsweise auch Diskriminierungen aufgrund der sozialen Herkunft (Klassismus) oder des Aussehens (Lookismus) vom AGG nicht erfasst.